Resilienzdimension 2: Strategie
Thomas Huber
31. August 2025
Anpassungsfähig statt planfixiert
Warum klassische Strategien in der Polykrise versagen
Multikrisen haben uns eines unmissverständlich gelehrt: Die Zukunft ist unberechenbar. Viele Führungskräfte fühlen sich angesichts dieser Volatilität auf unsicherem Boden, ihre sorgfältig ausgearbeiteten Pläne wirken schon kurz nach Veröffentlichung fragil.
Doch Verzweiflung ist keine Option. Stattdessen ist es an der Zeit, unsere Herangehensweise an Strategie radikal zu überdenken
Agile Strategie: Pläne, die atmen können
Agilität ist hier das Schlüsselwort. Es geht darum, Pläne zu schmieden, die atmen, die sich anpassen und die flexibel genug sind, um auf unerwartete Ereignisse zu reagieren.
Strategien müssen häufiger überprüft und angepasst werden, um relevant zu bleiben. Auch die Planungszyklen verkürzen sich drastisch – jährliche Strategie-Updates reichen oft nicht mehr aus, wenn schon in einem Quartal grundlegende Veränderungen eintreten können. Unternehmen und Behörden stehen vor der Herausforderung, ihre strategische Ausrichtung beizubehalten und gleichzeitig kurzfristig agil zu handeln.
Die Kunst der strategischen Balance: Effizienz trifft auf Redundanz
Warum Puffer überlebenswichtig sind
Resilienz bedeutet, Kernprozesse effizient zu halten, ohne auf Puffer zu verzichten. Organisationen brauchen beides: schlanke Abläufe und bewusste Redundanzen.
Eine resiliente Strategie erfordert die Fähigkeit, diese zwei scheinbar widersprüchlichen Ziele zu vereinen: die Optimierung des Kernprozesse (Effizienz) und die gleichzeitige Bereitstellung von Puffern. Viele Organisationen konzentrieren sich ausschließlich auf die Effizienzsteigerung im Bestehenden, was sie in stabilen Zeiten - wenn die notwendige Versorgung mit Energie funktioniert - erfolgreich macht. In turbulenten Zeiten sind diese "Organisation ohne Puffer" anfällig für Krisen und Unterbrechungen der Energiezufuhr (siehe Artikel 1).
Die Kunst der strategischen Balance liegt darin, beides gleichzeitig zu tun. Schaffen Sie Strukturen und Prozesse, die es ermöglichen, das Bestehende effizient zu betreiben und stellen Sie gleichzeitig Raum für Puffer, Innovation und Experimente bereit.
Eine solche Haltung ist natürlich eine bewusste Entscheidung und in sich schon eine Kollision mit einem mächtigen Kulturelement organisatorischer Vergangenheit: Nur "Ketzer" stellen das goldene Kalb der Effizienzsteigerung in Frage. Aber die gute Balance zwischen Effizienz und Puffer? - kann das Überleben sichern.
Best Practices: Familienunternehmen als resiliente Vorbilder
Wir sehen dies eindrücklich bei erfolgreichen deutschen Familienunternehmen, bei denen die Inhaber sich eindeutig und bewusst gegen die Gewinnmaximierung entscheiden und stattdessen (seit Generationen) Überschüsse gezielt in Reinvestitionen oder weitsichtige Lagerbestände bei Fertigteilen und Rohstoffen investieren. Obwohl Milliardäre, hat hier niemand eine Superyacht …
Strategische Agilität in der Praxis: Rollen, Prozesse, Routinen
Strategische Agilität bedeutet, die Organisation schnell auf neue Chancen oder Risiken auszurichten und Strategien iterativ weiterzuentwickeln. Agile Ansätze setzen auf häufige Zyklen von Planung, Umsetzung und Lernen.
Ein agiler Strategieprozess basiert weniger auf traditionellen, linearen Tools sondern ermöglicht vielmehr, die strategische Richtung bei Bedarf rasch zu korrigieren . Wichtig ist dabei ein Mix aus Analyse und Intuition – Datengetriebene Analytik gepaart mit unternehmerischem / fachlichem Urteilsvermögen.
Rollierende Planung & Strategie-Sprints
Agile Unternehmen oder Verwaltungen gehen zu rollierender Planung über.
Sehr bewährt haben sich vierteljährliche Strategie-Reviews, bei denen die obersten strategischen Prioritäten überprüft und aktualisiert werden .
Dies kann für eine Verwaltung bedeuten, sich - im Rahmen der definierten strategischen Ziele - auf (idealerweise weniger als 10) strategische Initiativen pro Jahr zu fokussieren, statt sich gleichzeitig auf alle 25 (eigentlich notwendigen) Projekte zu stürzen.
Zusätzlich werden quartalsweise Reviews eingeführt, um den Fortschritt zu messen und bei Bedarf Kurskorrekturen vorzunehmen. Diese regelmäßigen Strategie-Updates stellen sicher, dass die Ausrichtung kontinuierlich an aktuelle Anforderungen angepasst wird. Vor allem wird durch diese Art versucht, eine massive Überlastung einer eh schon "auf Kante genähten" Personalsituation zu vermeiden und schnelle, sichtbare Erfolge zu ermöglichen. Und es zeigt sich, dass Fokus und Agilität Hand in Hand gehen können.
Agilitätsmuster je nach Branche und Veränderungsdruck
Dennoch wirken in unterschiedlichen Brachen und je nach Veränderungsdruck unterschiedliche Agilitätsmuster: Diese Agility Patterns kombinieren systematische Planung mit unterschiedlich starker Flexibilität und „experimentellen“ Elementen, um entweder Trägheit (bei zu viel Starrheit) oder Chaos (bei zu viel Freiheit) zu vermeiden .
Nicht jedes Unternehmen kann also oder soll vollständig in den experimentellen Modus wechseln – es gilt, eine Balance zwischen Struktur und Flexibilität zu finden. So benötigen hoch regulierte oder sicherheitskritische Organisationen (z.B. in Verkehr, Energie, Verwaltung) eher resiliente Agilität – d.h. schrittweise Veränderungen und nahe am Plan –, während weniger kritische Branchen (Werbung, Kreativwirtschaft u.a.) sich transformational agile aufstellen können, also experimentierfreudig und mit höherer Fehlertoleranz.
Fazit: Jede Organisation muss ihr geeignetes Agilitätsniveau finden – doch agiler als früher muss heute jeder werden, um nicht von der Dynamik überrollt zu werden. Und resilienter muss jeder werden, um nicht der nächsten Krise zum Opfer zu fallen.
OKR vs. Balanced Scorecard: Strategische Umsetzung im Wandel
Unterschiedliche Tools für unterschiedliche Anforderungen
m Folgenden werden Ansätze vorgestellt, die in den letzten Jahren Erfolg versprechen, um mit höherer Komplexität und Geschwindigkeit umzugehen, und wie sie einen bestehenden Strategieprozess (wie den Ihren) sinnvoll ergänzen könnten.
Umsetzung mit kurzen Zyklen und Outcome-Fokus: OKR und Co.
Damit eine Strategie in einem volatilen Umfeld wirklich greift, muss auch die Umsetzungsmethodik an Tempo und Flexibilität gewinnen. Hier kommen moderne zielorientierte Führungs-Frameworks ins Spiel, allen voran OKR (Objectives and Key Results). OKR definiert ambitionierte, kurzfristige Ziele (Objectives) und ordnet ihnen messbare Schlüsselergebnisse (Key Results) zu.
Im Unterschied zur klassischen Balanced Scorecard (BSC), die einen stabilen, ganzheitlichen Blick auf verschiedene Perspektiven des Unternehmens (Finanzen, Kunden, Prozesse, Lernen) richtet und oft jährlich aktualisiert wird, setzen OKRs auf Fokussierung und häufige Anpassung:
- Adaptivität: OKRs lassen sich schnell an veränderte Marktbedingungen anpassen und fördern Ziele, die Innovation und Experimente erfordern. Balanced Scorecards dagegen betonen mehr Stabilität und Konsistenz der Ziele. In einer unsicheren Lage kann die OKR-Philosophie helfen, mutig neue Wege zu gehen und bei Misserfolg zügig umzusteuern, ohne an einem überholten Plan festzuhalten.
- Häufigkeit der Überprüfung: OKRs werden typischerweise vierteljährlich gesetzt und evaluiert, mit laufenden wöchentlichen Check-ins zum Fortschritt. Dies verkürzt den Steuerungszyklus drastisch. Die Balanced Scorecard wird klassisch oft nur jährlich oder halbjährlich umfassend betrachtet – was in einem schnellen Umfeld zu träge sein kann.
- Kultur und Fokus: OKRs passen besonders zu einer innovativen, agilen Unternehmenskultur, da sie ambitioniertes Denken, Transparenz und iterative Lernschleifen fördern . Die BSC fügt sich eher in traditionelle, strukturiert-planvolle Kulturen ein . OKRs zielen darauf ab, alle im Unternehmen auf kurzfristige Prioritäten einzuschwören, ohne den strategischen Überbau aus den Augen zu verlieren.
Balanced Scorecard vs. OKR – kein Widerspruch, sondern kombinierbar
Viele mittelständische Firmen nutzen bereits eine Balanced Scorecard zur Strategieumsetzung (so auch Sie, in Form von Handlungsfeldern und Kennzahlen). Statt OKR als Ersatz zu sehen, kombinieren führende Unternehmen (Google, LinkedIn, Intel, Deutsche Telekom) beide Ansätze, um das Beste aus beiden Welten zu erhalten. Die Balanced Scorecard bietet den ganzheitlichen, langfristigen Rahmen (Vision, strategische Perspektiven und Ziele), während OKRs agile Kurzfrist-Etappen innerhalb dieser Perspektiven setzen.
Eine Organisation, die sich frisch mit Strategieentwicklung und Strategieumsetzung beschäftigt, steht vor der Aufgabe, sich bewusst auf diese "diffuse Situation" einzulassen: jede Organisation muss ihre eigene Antwort darauf finden, wo klassische langfristige Leitplanken gesetzt werden sollen/müssen und wo echte Spielräume für flexible Moves bestehen.
Ihre resiliente Strategie – 6 konkrete Handlungsschritte
Um Ihre Strategie resilienter zu gestalten und Ihre Organisation zu befähigen, auf unvorhergesehene Ereignisse nicht nur zu reagieren, sondern gestärkt daraus hervorzugehen, können Sie folgende Schritte unternehmen:
- Etablieren Sie ein Strategie-Cockpit: Richten Sie ein kleines, agiles Team ein, das kontinuierlich das Umfeld scannt, Szenarien entwickelt und strategische Optionen bewertet. Dieses Team sollte direkt der Geschäftsleitung unterstellt sein und regelmäßig berichten.
- Führen Sie Strategie-Sprints ein: Statt jährlicher Strategiezyklen arbeiten Sie in kürzeren, iterativen Sprints (z.B. quartalsweise), in denen Sie Ziele überprüfen, Fortschritte bewerten und den Kurs anpassen.
- Fördern Sie strategisches Denken auf allen Ebenen: Schulen Sie Ihre Mitarbeiter darin, strategisch zu denken und Veränderungen im Umfeld zu erkennen. Machen Sie "Strategie- und Veränderungskompetenz" zu einem zentralen Skill in Ihrem Unternehmen. Ermutigen Sie Menschen, Ideen und Beobachtungen einzubringen, die für die Strategie relevant sein könnten.
- Investieren Sie in Daten und Analytik: Nutzen Sie moderne Analysetools und KI, um Muster und Trends in großen Datenmengen zu erkennen. Dies ermöglicht fundiertere und schnellere strategische Entscheidungen.
- Seien Sie mutig im Loslassen: Identifizieren Sie Bereiche, in denen Komplexität reduziert werden kann, und treffen Sie mutige Entscheidungen, sich von nicht-essentiellen Produkten, Prozessen oder Strukturen zu trennen.
- Setzen Sie Digitalisierung und KI ein, wo immer es sinnvoll und möglich ist: Sie können damit genau die Puffer schaffen, die sie unbedingt brauchen, um gleichzeitig effizient und resilient zu sein.
Das Wichtigste nochmal in Kürze:
- Agile, rollierende Strategieplanung: In Zeiten von Polykrisen müssen Unternehmen und Behörden ihre Planungszyklen drastisch verkürzen: Von jährlichen Updates hin zu vierteljährlichen Strategie-Checks und “Strategie-Sprints”, um Prioritäten laufend zu prüfen, Erfolge sichtbar zu machen und frühzeitig auf Veränderungen zu reagieren.
- Balance zwischen Effizienz und Redundanz: Resilienz entsteht durch das Zusammenspiel von schlanken Kernprozessen und gezielten Puffern (Redundanzen). Während reine Effizienzstrategien in stabilen Zeiten punkten, sichern Investitionen in Lagerbestände, Innovation und experimentelle Freiräume das Überleben in Krisen.
- Agile Umsetzungsframeworks (OKR vs. BSC): Moderne Frameworks wie OKR ermöglichen kurze, adaptive Ziel- und Review-Zyklen (quartalsweise mit wöchentlichen Check-ins) und fördern Innovations- und Lernschleifen. Die klassische Balanced Scorecard bleibt als langfristiger Rahmen bestehen und kann in Kombination mit OKRs das Optimum aus Stabilität und Flexibilität bieten.
Ausblick:
Eine wirklich resiliente Strategie erfordert nicht nur neue Tools und Prozesse, sondern vor allem den Mut zu kulturellem Wandel. Auf diesen Teil gehen wir fokussiert im Blog ein: "Resilienzdimension 4: Kultur". Dazwischen aber noch kommende Woche ein anderer Fokus: Resilienzdimension 3: STRUKTUREN UND PROZESSE
Wenn es leicht wäre, wäre es keine Strategieentwicklung …
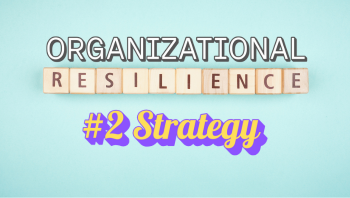

Über mich
Thomas Huber. Versteht, dass sich Menschen, Teams und Unternehmen nur gemeinsam entwickeln und entsprechend systemisch ist seine Beratung. Mit Genuss und Neugier hat er eine ziemliche Expertise in allen drei Feldern entwickelt. Neben Strategieentwicklung, Changeprozessen und Teamentwicklung ist die Künstliche Intelligenz in all ihren Anwendungsformen sein Steckenpferd - nicht nur in der Strategieberatung.

Copyright@2020 - ToChange.de
Alle Rechte Vorbehalten
Alle Rechte Vorbehalten
Kontaktiere Uns
-
+49-(0)941 600 93 003
-
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein. -
Thomas_Huber
ToChange Gmbh
-
Thomas Huber
-
Traubengasse 6
-
D-93059 Regensburg

