Organisationale Resilienz Intro
Was bedeutet organisationale Resilienz wirklich?
Oh, eine spannende Frage! Im Kern bezeichnet organisationale Resilienz die Fähigkeit eines Systems, sei es ein Unternehmen, eine Verwaltung/Administration oder auch eine ganze Gesellschaft, tiefgreifende Schocks und turbulente Veränderungen unbeschadet zu überstehen und daraus zu lernen.
Resiliente Organisationen stecken also nicht nur Rückschläge ein, sie absorbieren Schocks und wandeln sie in Chancen um. Es geht eben nicht allein darum, Krisen passiv "abzuwettern", sondern aktiv besser daraus hervorzugehen. Eine solche Organisation kann Störungen verkraften, sich flexibel an neue Gegebenheiten anpassen und sogar Verbesserungen anstoßen, während weniger resiliente Organisationen ins Straucheln geraten.
Resiliente Organisationen haben eine hohe adaptive Kapazität.
„Resilienz ist immer gut. Warum sollte ich mich jetzt direkt damit auseinander setzten?“
„Weil Störungen nicht mehr die Ausnahme sind. Sie sind der Taktgeber.“
Die Lage:
Störungen sind nicht mehr Ausnahme, sie sind Taktgeber. Auf der Infrastrukturebene spüren wir sie im Alltag: verspätete Züge, das Gesundheitsamt- und Sozialsystem am Anschlag, Lieferketten mit Husten.
Auf der Ebene der Superstruktur (des Staates) knirscht es leiser, aber tiefer: Vertrauen erodiert in Politik, Verwaltung, Medien — nicht dramatisch, sondern tropfend. Der schleichende Verlust an Leistungsfähigkeit in Politik und Behörden ist weniger sichtbar—bis er es ist.
Und auf der Megastruktur (die Ordnung, die Länder zusammenhält) verschieben sich Platten: Krieg in Europa, Blöcke, die sich neu ordnen, ein globaler Wettbewerb um Energie, Daten, Deutung. In der Sprache der Historiker (Harper lässt grüßen): Systeme stürzen selten auf einen Schlag. Sie erodieren, wenn mehrere Störungen synchronisieren—Klima, Krankheit, Krieg, Bürokratie—und die Puffer versagen,- nicht theoretisch, sondern wirklich. Das Ergebnis ist kein Einzelereignis, sondern Dauerlage.
Zwischen Sirene und Stille: Wie wir in der Polykrise fühlen, denken, handeln
Menschen reagieren auf diese Wirklichkeit unterschiedlich — und erstaunlich ähnlich. Viele unserer Kunden (und wir selbst) erleben Alarmmüdigkeit: Die nächste Krise trifft auf Nervensysteme im Standby. Andere greifen zu Mikrokontrolle: perfekter Kalender, perfekte Prozesse, To-do-Listen als Talisman gegen Zufall - als ließe sich Komplexität bügeln. Es gibt Rückzug ins Private (ich kann keine Nachrichten mehr ansehen) und die Flucht nach vorn in Hyperaktivität und Selbstoptimierung. Zynismus als Selbstschutz. Rituale als Beruhigungsmittel. Und zwischen all dem: eine unsichtbare zunehmende Grundspannung, die Teams, Familien, Unternehmen und Verwaltungen in knappe Sätze und scheinbar schmale Spielräume zwingt.
Die Organisationen:
In Unternehmen und insbesondere Behörden zeigt sich das psychologisch konkret: Entscheidungen über zentrale Themen werden gar nicht mehr herbeigeführt oder werden vertagt, bis sie sich von selbst erledigen — oder explodieren. Meeting-Tische werden zu Bühnen für symbolische Handlungen: Wir palavern, also sind wir. Führungskräfte verwechseln Härte mit Halt. Mitarbeitende sprechen seltener über Zweifel und Möglichkeiten zur Verbesserung, sondern häufiger über "Tickets". Das erzeugt Effizienzgeräusche ohne Wirksamkeit am Wesentlichen - aber es erzeugt keine Innovation.
Der dauerhafte Veränderungsdruck ist das „neue Normal“
Die Versuchung ist groß, das alles unter „Normalisierung des Ausnahmezustands“ abzulegen. Doch diese Art von Normalisierung in Organisationen betäubt. Sie ersetzt wirksames Handeln durch Gewöhnung. Subtil entsteht so das gefährlichste Narrativ dieser Zeit: Es wird schon gehen. Es geht — nur wohin?
Was früher als Worst-Case-Szenario in der Schublade lag, ist heute regelmäßige Herausforderung.
Wichtig zu verstehen: In früheren Zeiten, die - heute wissen wir das sehr viel besser - eindeutig durch Monokrisen (und nicht durch Poly-Krisen) kennzeichnet waren, haben wir unsere Organisationen immer komplexer gemacht, immer mehr ausdifferenziert. Und das ist absolut angebracht, solange es um die Lösung relativ einfacher Probleme geht.
Aus diesem Grund sind moderne Unternehmen und Behörden hochkomplexe Systeme geworden: spezialisiert, verflochten, viele oft bis an die Grenzen optimiert.
Komplexität und Energiezufuhr: Ein fragiles Gleichgewicht
Wenn Komplexität zur Belastung wird
Moderne Organisationen sind hochkomplexe Systeme weil die Probleme immer komplexer werden. Doch diese Komplexität ist nur tragfähig, solange die nötige Energiezufuhr (Ressourcen, Kapital, Personal) stabil bleibt, etwa in Form von:
stetigen Überschüssen bei den Einnahmen und liquiden Mitteln
planbare Verfügbarkeit von Rohstoffen und Material
kontinuierlich und schnell verfügbare Arbeitskraft
Stabile und "erleichternde" politische und institutionelle Rahmenbedingungen
Aber diese dringend erforderlichen Energiequellen und die entsprechende Energiezufuhr nehmen in der heutigen Polykrise ab, während die Komplexität unserer Unternehmen und Verwaltungen hoch bleibt und sogar immer weiter zunimmt.
Joseph Tainters Theorie: Warum Systeme kollabieren
Dessen Kollapsforschung zeigt: komplexe Gesellschaften kollabieren genau dann, wenn die Lösungen für ihre Probleme immer aufwendiger werden, aber immer weniger be-wirken.
Übertragen auf Organisationen heißt das: Wenn immer mehr Ressourcen in das Verwalten von Komplexität fließen – in Bürokratie, Abstimmung, Krisenbewältigung – ohne dass dadurch echte Fortschritte erzielt werden, gerät das System in Schieflage. Interne Trägheit und externe Turbulenzen ergeben zusammen eine gefährliche Mischung: Die "adaptive Kapazität" für einen erfolgreichen Umgang mit den Polykrisen sinkt oder geht gar verloren - man übersteht vielleicht die erste große Lawine, - aber die zweite und dritte?
Effizienz als Risiko: Wie schlanke Prozesse die Resilienz schwächen
Der Preis der Effizienzsteigerung
Hier noch ein weiterer großer Knackpunkt: Effizienzsteigerungen haben uns so lang gerettet, dass sie uns schließlich das Leben kosten.
Lange Zeit galt Effizienz als oberstes Gebot in Wirtschaft und Verwaltung. Prozesse wurden verschlankt, Lager auf „Just-in-Time“ getrimmt, Puffer ("Verschwendung") eliminiert, die Organisation immer mehr auf Effizienz ausgerichtet.
Diese Optimierungen haben Kosten gespart – aber oft um den Preis geschwächter Resilienz. Die Pandemie hat gezeigt, dass eine zu schlanke Organisation im Ernstfall teuer bezahlt wird:
- Wer keine Lagerbestände hat, kann nicht liefern, wenn Zulieferer ausfallen;
- Wer sein Personal bis auf Kante geplant hat, steht ohne Reserven da, wenn viele krank werden;
- Wenn Wissen nicht "redundant vorhanden" ist, bedeutet jeder Vorruhestand einen "Brain Drain" für das Unternehmen oder die Verwaltung;
- Wenn zu viel Gewinn an die Shareholder geht, fehlen die Mittel für notwendige Innovationen.
Beispiele aus der Praxis: Krankenhaus, Boeing & Co.
Konkrete Beispiele zeigen, wie fehlende Redundanzen und kurzfristiges Profitdenken Organisationen verwundbar machen.
So wurden z.B. in einem Bayrischen Krankenhaus wichtige Stellvertreter-Positionen aus Kostengründen abgeschafft;
Effekt kurzfristig: Kosteneinsparung;
Effekt langfristig: massiver Wissens- und Kompetenzverlust im Umgang mit kritischen Situationen, Komplettausfall wichtiger Positionen, wenn die Person im Urlaub ist oder wegen Krankheit ausfällt.
Im Falle von Boeing wurde ein fataler Kulturwandel weg von ingenieurischer Exzellenz hin zu Shareholder Value eingeleitet: Profitdruck und Zeitdruck sowie eine neu implementierte Kultur der Gewinnmaximierung und Kostensenkung beeinträchtigte Sicherheitsstandards und führte zu systemischen Problemen in Management und Entscheidungsprozessen und einem massiven Vertrauensverlust in das Unternehmen. Und letzten Endes zu den technischen Problemen aufgrund mangelnder Qualität, die im Worst Case zu Abstürzen von Flugzeugen führten.
Bei diesem Überfokus auf (Gewinn-) Optimierung geht die dringend erforderliche Balance zwischen Effizienz und Puffer verloren und die Resilienz gleich mit.
Resilienz braucht Balance: Effizienz trifft Puffer
Mehrdimensionale Resilienz statt Einzellösungen
Resilienz, verstanden nicht als Rückfederung, sondern als Vorwärtsfähigkeit unter Druck.
Resilienz heißt: Sinn klären, bevor Pläne gemacht werden.
Redundanzen als Prinzip verstehen, nicht als Verschwendung. (Zweitquelle, Zweitkompetenz, Zweitweg): It is a feature, not a bug!
Entscheidungsrhythmen verstetigen, die Schocks einkalkulieren.
Kulturen, in denen übergreifende Kommunikation und gemeinsamer Zweifel vor dem Konsens eine Kompetenz ist.
Und Strukturen, die im Kleinen robust und im Großen anpassungsfähig sind, die keine Egos füttern, sondern Flexibilität fördern.
Organisationale Resilienz ist kein Notfallplan, sondern ein Zusammenspiel aus Strategie, Struktur, Kultur und Purpose.
Und genau um diese wichtige Balance zwischen Effizienz und Puffer geht es uns als Beraterinnen und Beratern. Ganz sicher ist unser Ansatz nicht zu verstehen als Plädoyer für eine adipöse Organisation. Ohne jeden Zweifel gibt es in sehr vielen Unternehmen und Behörden die Notwendigkeit, Prozessoptimierungen ganz konsequent vorzunehmen.
Aber viel stärker als in den letzten Jahren, die geprägt waren von Effizienz- und Optimierungsdominanz, ist in der heutigen Situation unbedingt darauf zu achten, dass die überlebenswichtige Resilienz dabei nicht flöten geht. Das Ziel sollte ein bewusst entwickeltes Gleichgewicht zwischen Effizienz und Puffer, zwischen Kargheit und Fülle in Organisationen sein.
Harte und weiche Faktoren im Gleichgewicht
Um eine resiliente Organisation bewusst zu schaffen oder zu erhalten, müssen wir zunächst verstehen, dass Resilienz mehrdimensional ist. Oft wird sie mit Notfallplänen, Versicherungen oder technischen Backups gleichgesetzt – und gewiss gehören robuste Prozesse und Redundanzen dazu.
Doch echte organisationale Resilienz reicht viel tiefer: Sie wurzelt in den sorgfältig entwickelten Resilienz-Dimensionen Strategie, Struktur, Kultur und Purpose.
Eine resiliente Organisation vereint damit sog. "harte und weiche" Faktoren: Sie hat einerseits eine klare Ausrichtung für ihre Strategie, dazu belastbare Systeme und flexible Pläne, andererseits auch eine Kultur und einen klaren Sinnhorizont, der ihren Mitgliedern Orientierung gibt. Diese Kombination verleiht ihr Vitalität durch Anpassungsfähigkeit.
Fazit: Resilienz ist systemisch, oder gar nicht
Wer Resilienz ernst meint, darf nicht bei Einzelaktionen stehen bleiben: Sie entsteht dort, wo Purpose, Strategie, Struktur und Kultur ineinandergreifen. Resilienz ist keine einzelne Maßnahme, sondern ein Zustand synchronisierter Lern- und Wandlungsfähigkeit, tief verankert im gesamten Führungssystem der Organisation.
Und zudem wird immer klarer: eine resiliente und anpassungsfähige Organisation ist keine luftige Verzierung einer Wohlstandsorganisation.
Sondern Resilienz ist überlebensnotwendig und ein zentraler Führungsauftrag.
Resiliente Organisationen stecken also nicht nur Rückschläge ein, sie absorbieren Schocks und wandeln sie in Chancen um. Es geht eben nicht allein darum, Krisen passiv "abzuwettern", sondern aktiv besser daraus hervorzugehen. Eine solche Organisation kann Störungen verkraften, sich flexibel an neue Gegebenheiten anpassen und sogar Verbesserungen anstoßen, während weniger resiliente Organisationen ins Straucheln geraten.
Resiliente Organisationen haben eine hohe adaptive Kapazität.
Quellen:
Kyle Harper: The Fate of Rome: Climate, Disease, and the End of an Empire (2017)
Joseph Tainter: The collapse of complex societies (1990)
Ausblick: Das erwartet Sie in den kommenden Blogs:
In den folgenden Artikeln gehen wir deshalb bei jeder dieser Resilienzdimensionen PURPOSE, STRATEGIE, STRUKTUR, KULTUR in die Tiefe – mit praktischen Ansätzen, die nicht nur inspirieren, sondern umsetzbar sind.
Wir hoffen sehr, dass Sie genügend eigenen Puffer haben, um sich auch die anderen Artikel bis zum Ende durchzulesen.
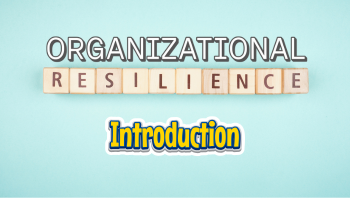

Über mich

Alle Rechte Vorbehalten
Kontaktiere Uns
-
+49-(0)941 600 93 003
-
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein. -
Thomas_Huber
ToChange Gmbh
-
Thomas Huber
-
Traubengasse 6
-
D-93059 Regensburg

